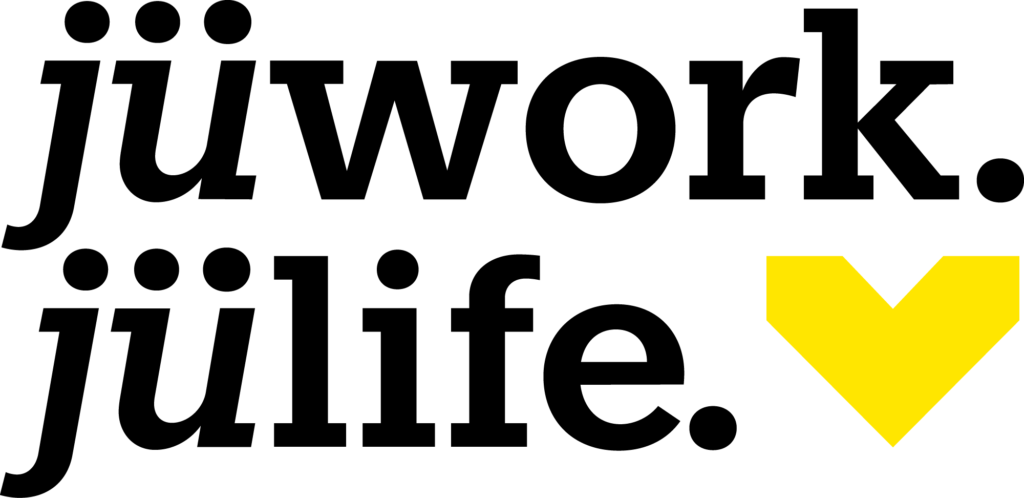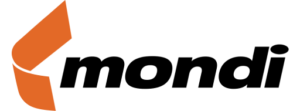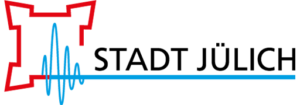Jülich stellt sich an vier Orten der Erinnerungskultur an Krieg und Verfolgung
Zu den zahlreichen Verbrechen der NS-Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs gehört die systematische Ausbeutung von Kriegsgefangenen als Zwangsarbeiter. Männer, Frauen und Kinder, besonders aus Russland, der Ukraine und Polen, aber auch aus Belgien waren in dem Lager untergebracht und wurden zum überwiegenden Teil im Reichsbahnausbesserungswerk (RAW), einige in der Landwirtschaft eingesetzt. Hinzu kamen 1943 für eine kurze Zeit auch zahlreiche Franzosen, die zuvor bei der Friedrich Krupp GmbH in Essen-Borbeck gearbeitet hatten. Zeitweilig waren über tausend Menschen zwangskaserniert. Seit 1985 erinnert ein durch Pax Christi initiiertes orthodoxes Gedenkkreuz des Bildhauers Friedel Denecke und eine Infotafel an die traurige Vergangenheit des Ortes. Die Unterschutzstellung als Bodendenkmal an der Leo-Brandt-Straße ist ein wichtiger Schritt, die Erinnerung an diesen unbequemen Teil der Jülicher Vergangenheit wach zu halten. Gleichzeitig ist sie eine Verbeugung vor den vielen namenlosen Toten, die hier ihre letzte Ruhe gefunden haben.
Das Denkmal zum 16. November wurde auf dem Schlossplatz 1954 anlässlich der 10. Wiederkehr der Zerstörung der Stadt Jülich errichtet. Der Entwurf der Plakette stammt vom Jülicher Grafiker Dietmar Biermann. Der Stein stammt einem Artikel in der Jülicher Volkszeitung vom 17. November 1954 zufolge aus dem Odenwald. An diesem Mahnmal findet normalerweise die Gedenkfeier zur Zerstörung Jülichs statt, die in diesem Jahr wegen der Pandemie gemeinsam mit dem Gedenken zum Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof an der Linnicher Straße begangen wird.
16 Jahre lang wurde um die Gedenkstätte für die Leistungen von Jülichern für den Wiederaufbau – insbesondere der Frauen gerungen, die heute in direkter Nachbarschaft des Mahnmals zur Zerstörung Jülichs 1944 auf dem Schlossplatz steht. Die Initiative geht auf Gerta Mojert zurück, die als junge Frau diese Zeit und den Einsatz der so genannten „Trümmerfrauen“ intensiv miterlebte. Im Zuge der Innenstadt-Umgestaltung 1987 fühlte sie sich an die Nachkriegszeit erinnert und formulierte den ersten Antrag. Trotz reichlich Widerstand aus Politik und Verwaltung kam es schließlich im Jahr 2000 mit Unterstützung von Dr. Peter Nieveler als Geschäftsführer des Brückenkopf-Parks und Conrad Doose als Vorsitzendem des Fördervereins Festung Zitadelle zu Plänen für eine Umsetzung. Der Architekt Prof. Jürgen Eberhardt entwarf mit beratender Unterstützung von Norbert Freudenberg und dem Stolberger Restaurator und Denkmalpfleger Peter Möhring letztlich das Mahnmal – so ist es in der Jülicher Zeitung anlässlich der Einweihung am 11. April 2003 nachzulesen. Ausgeführt haben es die Hauptwerkstätten des Forschungszentrums Jülich.
Den ermordeten Menschen jüdischen Glaubens im Jülicher Land ist das Mahnmal auf dem Propst Bechte Platz gewidmet. Geschaffen von Michael Wolf, einem Bildhauer und Steinmetz aus Jüchen. 135.000 DM hat das künstlerische Mahnmal gekostet. Beteiligt haben sich durch Spenden viele Institutionen, Unternehmen, Privatpersonen und Vereine an diesem Projekt. Das Mahnmal besteht aus zwei geschwungenen schwarzen indischen Granitblöcken, die aus vier Einzelteilen zu den beiden geschwungenen Mauern zusammengesetzt worden sind. Zwei menschliche Skulpturen stehen sich hier gegenüber, um ein Aufeinander-zu-gehen zu symbolisieren. 250 namentlich bekannte Opfer sind hier im wahrsten Sinne in Stein gemeißelt. Alljährlich findet das Finale der Gedenkfeier zu Pogromnacht am Mahnmal Propst-Bechte-Platz statt.
Mehr unter https://www.herzog-magazin.de/featured/mahn-und-ge-denkmaeler-in-juelich/